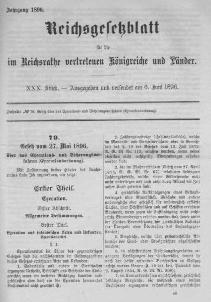|
Bereits 1311 wurde in der Wiener
Rossau, als eine der ersten festen Hinrichtungsstätten, der Rabenstein
errichtet. Der Henker gehörte ab dem 14. Jahrhundert neben dem Abdecker, dem Müller, Schäfer, Leinenweber, Töpfer, Bader, Bartscherer und vor allem den Gauklern, Juden und Zigeunern sowie den unehelich Geborenen zu den "unehrlichen Leuten". Die unehrlichen Leute wurden in keine Handwerkszunft aufgenommen und durften kein städtisches Amt ausüben. Der Henker des Spätmittelalters durfte oftmals nicht in der Stadt wohnen und wurde ihm selbst bei der Messe ein eigener, abgesonderter Platz zugeteilt. Schenken und Wirtshäuser durfte er nur betreten, wenn sich keiner der anderen Gäste dagegen aussprach. |
|